Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
Einführung
- Künstliche Intelligenz umfasst eine Vielzahl von Algorithmen zur automatisierten Datenverarbeitung
- Entscheidungsbäume gehören zum Bereich des maschinellen Lernens
- Fokus dieser Vorlesung: Methoden des überwachten Lernens
- maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der KI, bei dem Systeme aus Daten lernen statt explizit programmiert zu werden
Zentrale Algorithmen
- ein zentral gesteuerter Algorithmus verwaltet Daten, Parameter und Logik an einem einzigen Ort
- Vorteil: einfache Struktur, leicht zu implementieren
- Nachteil: zentraler Ausfallpunkt, eingeschränkte Skalierbarkeit
- Nachteil: zentraler Ausfallpunkt, schlecht skalierbar bei verteilten Aufgaben
- Beispiel: ineffizient zur Steuerung ganzer Fahrzeugflotten
- zentrale Modelle wie Entscheidungsbäume folgen einer klaren, regelbasierten Struktur und sind gut interpretierbar
Überwachtes Lernen: Grundidee
- Ziel: aus Eingabevariablen \(X\) eine Vorhersage \(Y\) oder \(G\) ableiten
- auch möglich: geordnete Kategorien (z. B. klein, mittel, groß) – hier nicht behandelt
- Regression: \(Y\) ist quantitativ, z. B. Preis, Temperatur, Gewicht
- Klassifikation: \(G\) ist qualitativ, z. B. Klasse
Ja/Nein'',rot/blau’’ - ``überwacht’’ bedeutet: Trainingsdaten enthalten Zielgrößen zur Kontrolle des Lernprozesses
- beide Aufgaben lassen sich als Funktionsapproximation formulieren
- Trainingsdaten bestehen aus Paaren \((x_i, y_i)\) oder \((x_i, g_i)\)
Beispiel: Klassifikation mit Iris-Daten
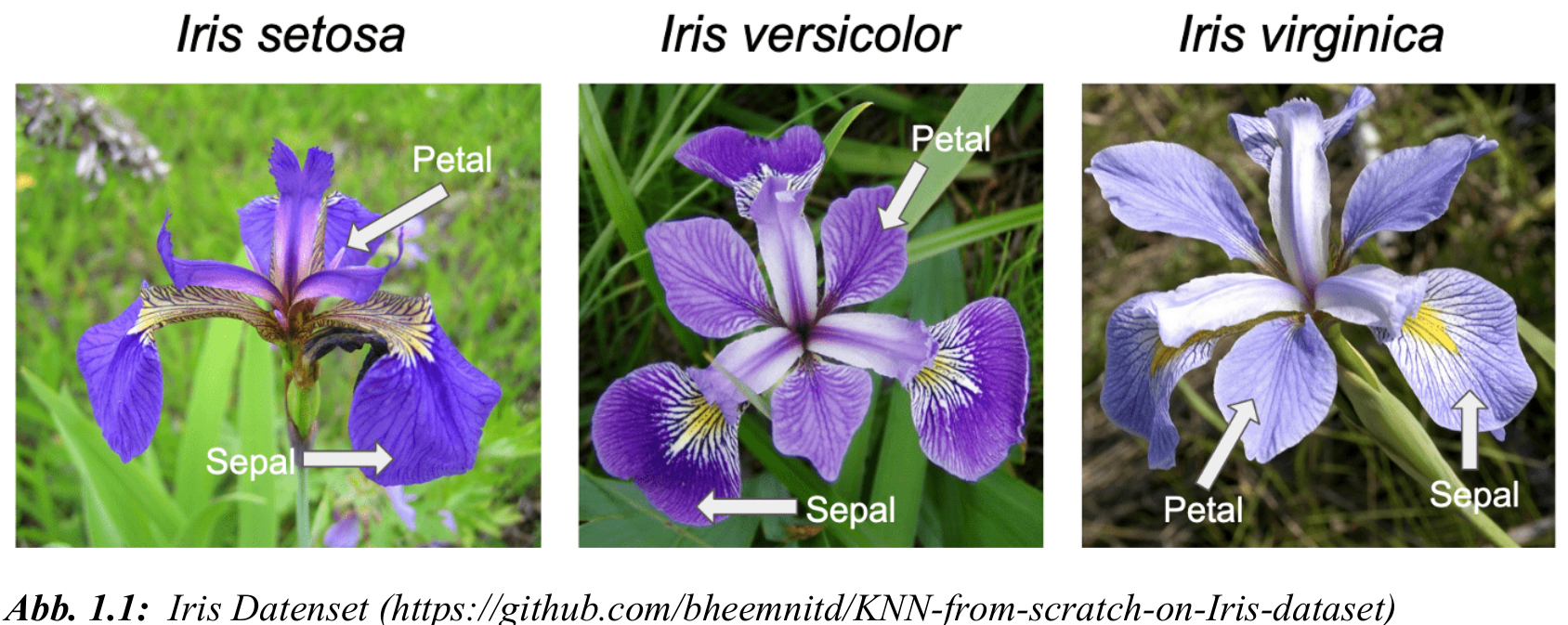
- Eingabe: Länge und Breite von Kelch- und Blütenblättern
- Sepal = Kelchblatt vs. Petal = Blütenblatt (siehe Bild)
- Ziel: Vorhersage der Iris-Spezies (setosa, versicolor, virginica)
- typische Klassifikationsaufgabe mit \(G \in \{1, 2, 3\}\)
Hintergrund zum Datensatz
- stammt aus einer Studie von Ronald Fisher (1936)
- enthält 150 Beobachtungen, je 50 pro Iris-Art:
setosa,versicolor,virginica - für jede Pflanze sind 4 Merkmale gegeben: Kelchblatt-Länge/Breite und Blütenblatt-Länge/Breite
- seit Jahrzehnten Standard-Datensatz zum Testen von Klassifikationsverfahren
- gut geeignet für visuelle Trennung & erste Modellbeispiele
Notation
Eingabedaten (Input)
- \(\bs{X} \in \mathbb{R}^{N \times p}\): Matrix aller Inputvektoren und eine Input/Eingabe: \(\bs{x}_i \in \mathbb{R}^p\), \(i = 1, \dots, N\) Beobachtungen
- dazugehöriger Zeilenvektor: \(\bs{x}_i^T\) (transponierter Spaltenvektor) der \(i\)-ten Beobachtung
\[ \bs{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\\\ \vdots & \vdots & & \vdots \\\\ x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ip} \\\\ \vdots & \vdots & & \vdots \\\\ x_{N1} & x_{N2} & \dots & x_{Np} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \bs{x}_i^T = \text{i-te Zeile} \]
- für den Iris Datensatz wäre \(p=4\), \(N=150\) und die Reihenfolge
- \(\bs{x}_i^T\) enthält alle vier Merkmale der \(i\)-ten Blüte:
sepal_lengthsepal_widthpetal_lengthpetal_width - Beispiel: \(x_{i2}\) = sepal-Breite der \(i\)-ten Blüte, und \(x_{N3}\) = petal-Länge der \(N\)-ten Blüte
Zielgrößen (Output)
- \(Y_i \in \mathbb{R}\): quantitatives Ziel (Regression)
- \(G_i \in \Omega\): qualitatives Ziel (Klassifikation), z. B. \(\Omega = \{\text{setosa}, \dots\}\)
- \(\hat{Y}_i\), \(\hat{G}_i\): geschätzte Ausgaben
- Ziel: \(\hat{Y}_i \approx Y_i\), \(\hat{G}_i \approx G_i\)
- Binäre Klassifikation für binäres \(G\): \(\hat{Y}_i \in [0, 1]\) und Schwellenwert-Regel z. B. für Wert 0.5:
\[ \hat{G}_i = \begin{cases} 1 & \text{falls } \hat{Y}_i \geq 0{,}5 \\\\ 0 & \text{falls } \hat{Y}_i < 0{,}5 \end{cases} \]
